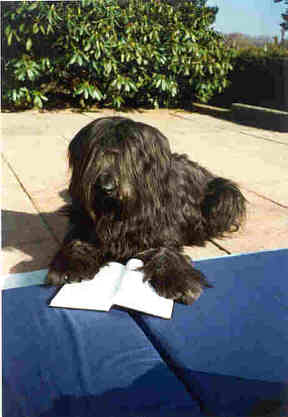Erziehung und Ausbildung
Briards in Not - Armutszeugnis für die Halter
von Dr. Gabriele Niepel
Wer als Hundehalter im allgemeinen und Briardliebhaber im besonderen die Zahlen liest, wie viele Briards pro Jahr weitervermittelt werden müssen, weil ihre Erstbesitzer sie nicht mehr halten können oder wollen, der muss erschrecken.
Als ich einmal auf einer Mitgliederversammlung eine Zahl von um die 80 von Ingrid Gossens hörte, dachte ich noch, ich hätte mich verhört, es hätte 18 heißen müssen. Weit gefehlt. Für das Jahr 2002 hören wir von Ulrike Theumer, dass 61 Briards zur Vermittlung anstanden. Und wir erfahren noch mehr: In der Regel werden die Hunde wegen „Verhaltensproblemen“ abgegeben, wobei offenbar die erwachsen werdenden Briardrüden einen Großteil stellen.
Ulrike Theumer hatte mich angerufen und wir haben darüber geredet, wie es dazu kommen kann, dass so viele Briardbesitzer mit ihren Schätzchen nicht fertig werden. Ulrike wunderte sich vor allem darüber, dass dies auch Hunde betrifft, die erfolgreich Hundesport betreiben, die eine BH haben, Agility oder Schutzdienst machen, etc. Mich wundert das nicht und so hatten wir ein langes Gespräch, im Laufe dessen mich Ulrike bat, doch etwas darüber für die Briardrevue zu schreiben. Eine Bitte der ich hiermit nachkomme.
Der Hund - ein nicht demokratisch gestimmtes Rudeltier
Das heutige Problem in der Hundehaltung liegt schlicht und einfach darin, dass zu viele Hundehalter dabei versagen, ihrem Hund verständlich und überzeugend klar zu machen, dass nicht er, sondern sie der Chef des Familienrudels sind und daher im Zweifelsfalle zu entscheiden haben, was das Rudel als Gesamtes oder die einzelnen Rudelmitglieder im Besonderen zu tun und zu lassen haben.
Wir müssen uns schon damit abfinden, dass Wölfe und Hunde keine Demokraten sind - auch wenn das vielen Hundehaltern und -trainern nicht in ihr Weltbild passt. Alpha- und Dominanzkonzepte müssen jedoch überdacht werden, wie die neuere Forschung zeigt.
Die Ordnung im Hunderudel
Fassen wir einmal kurz zusammen:
Das Leben im Hunderudel verläuft in einer hierarchischen Ordnung. Das bedeutet, dass jedes Mitglied eine genau definierte Stellung hat. Es gibt einen weiblichen und einen männlichen Rudelboss, die anderen Rudelmitglieder stehen auf jeweils abgestuften Positionen darunter. Die Vorstellung, es gäbe nur ein männliches Leittier, ist mittlerweile dahingehend revidiert worden, dass es offenbar zwei getrennte Rangordnungen zwischen männlichen und weiblichen Rudelmitgliedern gibt. Und: Es hat den Anschein, dass in vielen Fällen die Hündin und nicht der Rüde bestimmt, wo es langgeht.
So weit, so gut. Aber: Diese Ordnung ist nicht statisch, und zwar in vielerlei Hinsicht:
1. Einzelne Rudelmitglieder versuchen, sich in der Hierarchie nach obe zu arbeiten, weil die oberen Plätze mit den besseren Lebensbedingungen einhergehen: Wer darf z.B. die fettesten Stücke der gemeinsam erlegten Beute fressen, wer darf decken, bzw. gedeckt werden und damit die Chance zu eigenem Nachwuchs bekommen, etc. Aber auch Bosse werden älter, „funktionieren“ weniger gut, die Ablösung durch einen Jüngeren steht an. Die Jungen müssen erst einmal untereinander klarstellen, wer den Boss herausfordern darf. Ist das geklärt und hat dieses Tier dem Rudelchef eine Niederlage zugefügt, so ist es zum neuen Boss aufgestiegen, dem sich nun die anderen unterzuordnen haben.
2. Die Rudelführung wird situationsabhängig getroffen, d.h. wenn z.B. ein in der Rangordnung niedrig stehendes Tier einfach der schnellste Sprinter ist, kann dieses durchaus an der Spitze des Rudels eine Jagd auf ein Wildtier anführen. Geht es dagegen dicht an die Territoriumsgrenzen des Rudels, ist es das ranghöchste Tier das führt.
3. Die Qualität eines wirklichen Führungstiers ist gerade daran abzulesen, dass es nicht immer auf seinen Anspruch an Führung, Entscheidung - und vor allem Erhalt, Besitz, Verteidigung der bestehenden Ressourcen besteht, sondern auch hier situationsabhängig agiert, wobei äußere Merkmale der Situation ebenso einfließen wie einfach die momentane Befindlichkeit des Cheftieres. Mal ist er so gut gelaunt, dass er die schnöseligen Frechheiten eines Pubertierenden schlichtweg ignoriert, ein andermal hat er einfach schlechte Laune und es gibt eine harsche Zurechtweisung.
Neuere Forschungen weisen darauf hin, dass man es nicht mit einer völlig eindeutig strukturierten Ordnung zu tun hat, sondern dass es oft auch zum Tausch von Positionen kommt, die dann wieder rückgängig gemacht werden. Leittiere räumen gelegentlich ihren Untergebenen Rechte ein, die eigentlich nur ihnen selbst zustünden, sie haben es nicht nötig, ständig den Chef heraushängen zu lassen - aber das können nur die wirklich Souveränen!
Rangordnung wird nicht darüber hergestellt, dass im Rudel permanent körperlich gekämpft wird - das wäre für die Gesamtheit des Rudels fatal, da es mit der Schwächung einzelner Rudelmitglieder einherginge. Vieles läuft auf subtilen Wegen ab, ohne Einsatz von körperlicher Gewalt. Dennoch wird auch körperlich eingewirkt. Aber diese Einwirkung wird äußerst dosiert eingesetzt; kurz, knapp, aber heftig und in der Regel so eindrücklich, dass eine Auseinandersetzung genügt. Der Boss im Rudel ist keinesfalls per se das körperlich stärkste Tier, sondern er zeichnet sich durch geistige Überlegenheit, ruhige Autorität, erfolgreiches Handeln aus.
Bereits den Welpen werden von den Alttieren bewusst Grenzen gesetzt, sie müssen lernen, wo sie in der Hierarchie stehen und dass sie diese zu respektieren haben. Im Prozess des Aufwachsens erlernen die jungen Hunde die Kommunikation unter Hunden. Ein Bestandteil dieser Kommunikation ist es, wie man in einer Situation die Überlegenheit eines anderes Hundes erkennt, wie man sich einem solchen gegenüber verhält, wie man selber dominieren kann.
Ein Hund braucht ein Leben in einer für ihn klar ersichtlichen Rangordnung. Lebt er mit Menschen zusammen, sind diese sein Rudel. Gesteht der Mensch dem Hund eine über ihm angesiedelte Position zu, darf er sich nicht wundern, wenn sein Hund diese voll ausnutzt indem er sich z.B. mit seinen Zähnen dagegen wehrt, vom gemütlichen Fernsehsessel vertrieben zu werden.
Einordnung schafft Sicherheit - für den Hund!
Der Hund ist als Rudeltier nicht nur daran gewöhnt, dass er sich in einer Hierarchie einordnen muss, in der klare Regeln und Verantwortlichkeiten bestehen, sondern er braucht diese auch. Es ist unser Job als Hundehalter sich vom ersten Tag an als Rudelführer verhalten und damit dem Hund wesentlichen Halt zu geben.
Viele Hunde, die keine klare Einordnung in ihr Familienrudel erfahren, fühlen sich alles andere als wohl - ihnen fehlt die Sicherheit ihre Geschicke vertrauensvoll ganz in die Hände eines Rudelbosses legen zu können. Solche Hunde stehen häufig permanent unter Stress, mit nachteiligen Auswirkungen auf ihr gesamtes Verhalten. Nicht umsonst steht in der Therapie extrem ängstlicher Hunde in der Regel die Klarstellung der Beziehung zum Halter zunächst einmal im Vordergrund, denn oft zeigt sich, dass der Hund in einer alles andere als klar geregelten Beziehung in übergeordneter Position lebt.
Die besonderen Eigenschaften des Briards
Nun unterscheiden sich Hunde aber in zwei sehr wesentlichen Punkten:
1. Zeigen sie ausgeprägtes Streben in der Rangordnung nach oben zu kommen oder sind sie zufrieden mit der Position, die ihre Halter ihnen zugestanden haben?
2. Wenn sie eine ranghohe Position innehaben - nutzen sie diese dann auch in aller Konsequenz aus?
Tja, und damit sind wir bei unseren Briards angelangt:
Der Briard gehört eindeutig zu den Rassen, die ein sehr sensibles Rangordnungs- und Autoritätsverständnis haben. Warum ist das so? Kurz gesagt, weil er nicht der ist, für den ihn viele halten: Er ist kein klassischer Hütehund.
Im Prozess der Domestikation ist der Hund zunächst hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt seines „Gebrauchs“ gezüchtet worden, was natürlich bestimmte Charaktereigenschaften erforderte.
Zwar spielen die ursprünglichen Zuchtziele auf einen bestimmten „Job“ hin in der heutigen Zeit nur noch eine untergeordnete Rolle, aber darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass unsere Rassen noch spezifische genetische Potentiale mitbringen.
Für das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund hat die genetische Veranlagung des Hundes Konsequenzen, denn je nach Verhaltenseigenschaften des Hundes stellen sich für seine Erziehung spezifische Herausforderungen.
Und hier muss man klar festhalten:
1. Der Briard sucht nach einer klaren Ordnung in seinem Rudel
2. Kann er diese nicht erkennen, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zuge seines Erwachsenwerdens, also ca. nach dem vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr daran machen, selbst diese Position zu übernehmen
3. Hat er sich diese - ob nun eher subtil oder offen - erkämpft, will er sie auch behalten und wird sich Frechheiten seines Menschen nicht gefallen lassen und entsprechend agieren, was selbstverständlich auch Aggressionsverhalten in den unterschiedlichen Stufen beinhaltet, bis hin zum reglementierenden Biss.
Warum ist das so beim Briard?
Nun, vielleicht setzt sich endlich die Erkenntnis durch, dass unsere Briards nicht die klassischen Hütehunde sind, als die sie leider auch von Züchtern immer noch verkauft werden. Sie unterscheidet ein wesentliches Merkmal von den reinen Hütehunden wie z.B. dem Border Collie und dem Bearded Collie: Sie hatten immer neben ihrer Hütetätigkeit auch Wach- und Schutzaufgaben zu erfüllen. Und das bedingt einen Hund mit folgenden Eigenschaften:
Er braucht ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Entschlussfreude.
Er muss außergewöhnlich aufmerksam sein, seine Umwelt genau beobachten.
Er braucht selbstbewusstes Auftreten.
Er benötigt ein entsprechendes Aggressionspotential um seinen Verteidigungsaufgaben gerecht zu werden.
Alle vier Eigenschaften prädestinieren ihn zu dominantem Verhalten.
Natürlich ist ein Briard wiederum etwas anders als ein klassischer Herdenschutzhund, der nichts mit Hüten am Hut hat, sondern „nur“ aufpassen und verteidigen muss und will. Entsprechend einfacher hat man es in der Erziehung und Einordnung eines Briards im Vergleich zum Herdenschutzhund, aber eben auch schwieriger im Vergleich zum reinen Hütehund.
Warum? Nun, der reine Herdenschutzhund ist auf absolute Eigenständigkeit hin gezüchtet, der geht nicht erst zum Schäfer melden und anfragen, was man denn jetzt mit dem Bären zu tun gedenke. Er braucht auch kaum Kommandos lernen, also sind diese Hunde nicht gerade darauf gepolt, mit einem Menschen zusammen zu arbeiten und machen ihr eigenes Ding. Hütehundbesitzer haben dagegen in der Regel wenig Probleme damit den Hund zur Mitarbeit zum gemeinsamen Tun zu bewegen - dafür ist ein Hütehund schließlich auch gezüchtet.
Tja, unsere Briards sind nun eine Mischung aus beiden. Sie sind gelehrig und wenn man sie richtig anpackt hochmotiviert zur Arbeit, gleichzeitig aber haben sie sehr wohl ihren eigenen Kopf, tragen einen Teil Eigenständigkeit in sich, vor allem aber die Suche nach klaren Positionen - und genau daran scheitern viele Briardbesitzer. Sie sehen nur diese unglaublich süßen, knuddeligen, Knopfaugenteddys, die eine so starke emotionale Bindung zur ihrer Familie zeigen, oft mit ihrem clownesken Verhalten alle begeistern und mit ihrem Temperament und ihrer Lebenslust einfach Frohsinn verbreiten. Und in diesem Hund soll ein selbstbewusster, auch eigenständiger Hund stecken, der seine Familie genau auf ihre Schwächen hin beobachtet und analysiert, seine Schlüsse zieht und entsprechend handelt?
Problematische Hundehaltertypen
In meiner Problemberatungsarbeit stelle ich immer wieder drei Hundehaltertypen fest, die Dominanzprobleme mit ihren Hunden haben:
1. Die eine Gruppe glaubt ihren Hund ständig mit Liebesbeweisen überschütten zu müssen. Jeder Wunsch wird ihm von den Lippen abgelesen. Mag er sein Futter nicht, bekommt er ein anderes hingestellt, besteht er beim Spaziergang im Regen darauf, umzukehren, dreht sein Besitzer selbstverständlich um, knurrt er beim Fressen, ziehen sich die Besitzer verständnisvoll auf Zehenspitzen aus der Küche zurück. Dem Hund werden keine Grenzen gesetzt - man ist ja demokratisch eingestellt. Erziehung wird gleichgesetzt mit dem Entzug von Freiheit und das will man dem süßen Kleinen nicht antun. Häufig handelt es sich um Besitzer kleinerer Rassen, aber so etwas gibt es durchaus auch bei Besitzern von großen Hunden. Und auch bei Besitzern von Briards!
2. Die zweite Gruppe glaubt ihrem Hund durch das ständige Abverlangen von Unterordnungsübungen, die Anwendung (harter) körperlicher Bestrafung und das Halten des Hundes auf Distanz (räumlich wie psychisch verstanden) klarzumachen, wer der Boss ist. Überschüttet die erste Gruppe ihre Hunde mit Liebe, will sich die zweite Gruppe mit dem Verweis auf eine zu verteufelnde Vermenschlichung des Hundes mit Liebesbeweisen bedeckt halten. Häufig halten diese Besitzer größere Hunde, nicht selten in Zwingern.
3. Die dritte Gruppe ist sich der Notwendigkeit einer Erziehung prinzipiell bewusst, will das alles aber nicht so eng sehen. Sie besucht einen Hundekurs, übt einmal die Woche, vielleicht sogar auch unter der Woche. Auf die Korrektheit der Übungen kommt es nicht so genau an. Wenn sich der Hund nicht gleich hinsetzt - egal, Hauptsache, beim vierten Befehl sitzt er endlich. Zieht er permanent an der Leine, ist er eben vom Lieblingsfeind abgelenkt - da kann man nichts machen. Im Alltag muss der Hund durchaus mal Sitz und Platz machen, einigermaßen anständig an der Leine gehen - aber ansonsten werden ihm keine Grenzen gesetzt, er läuft halt so als geliebter Kumpel mit. Diese Gruppe hält Hunde jeglicher Größe und Charakterbeschaffenheit. Briardbesitzer findet man häufig in dieser Gruppe.
Die Gruppen 1 und 3 können Dominanzprobleme bekommen - weil dem Hund keine Grenzen gesetzt werden oder dies nur halbherzig geschieht, weil die Besitzer sich inkonsequent verhalten, weil sie sich benehmen, als seien sie dem Hund nachrangig.
Aber auch Hundehalter der zweiten Gruppe können Probleme bekommen, wenn sie an den falschen Hund geraten. Ein zu ängstlicher Hund wird die Behandlung nicht vertragen und zusammenbrechen, dafür aber keine Dominanzprobleme bereiten. Ein einigermaßen wesensfester Hund wird bei der Behandlung ein gehorsamer, aber nicht glücklicher Hund werden. Ein wirklich wesensfester und noch dazu dominant veranlagter Hund könnte sich jedoch gegen die ungerechtfertigte Härte seines „Meisters“ auflehnen. Diese Hundetypen der Gruppe 2 werden tatsächlich eher zu gehorsamen Verhalten neigen als die Hunde in der Gruppe 1 und 3, doch sie werden ihre Besitzer nicht als Leitfigur ansehen, der sie voll und ganz vertrauen, zu der sie aufsehen können.
Was ist eigentlich „Dominanz“?
In der Hundeszene wird zur Zeit heftigst über Dominanzkonzepte gestritten. Das reicht von der Ansicht, so etwas wie einen dominant veranlagten Hund gäbe es gar nicht, weil sich Dominanz ja immer nur in der Beziehung zwischen zwei Individuen darstelle, bis hin zu Extrempositionen, die so weit gehen, dass man dem Hund nur dann Aufmerksamkeit schenken dürfe, wenn man mit ihm spazieren – Verzeihung, „jagen“ - gehe, denn nur darauf laufe es in der Mensch-Hund-Beziehung hinaus: Man müsse sich als Mensch als der Führer in der gemeinsamen Jagd erweisen. So etwas gipfelt dann in Hinweisen, dass auch wir als Hundebosse den Hund links liegen lassen müssen, wenn wir nicht mit ihm draußen sind, da das Wolfsrudel angeblich nur auf der gemeinsamen Jagd miteinander interagiere.
Es ist schon vertrackt: Die einen, denen es noch nie gepasst hat, dass ihr Hund kein demokratisch gesinntes Wesen ist, sehen in den die starren Dominanzkonzepte relativierenden Forschungen jetzt für sich die Chance die Notwendigkeit einer Rudelführerschaft gänzlich zu verneinen, woraus dann auch der Schluss zu ziehen ist, dass ein Hund nur dann einen Befehl auszuführen habe, wenn der für ihn auch einen Sinn mache, alles andere sei Gewaltausübung am Hund.
Die anderen sehen in allen möglichen Verhaltensweisen des Hundes nur noch eine Dominanzgeste - wie in der Tatsache, dass ein Hund sich auf die Füße seines Menschen legt. Warum tut er das? Na klar, er will seinen Menschen dominieren. Indem er sich auf die Füße liegt, schränkt er dessen Bewegungsfreiraum ein, der Mensch kann sich nicht fortbewegen ohne dass der Hund es zulässt. Nun, das kann im Einzelfall tatsächlich eine Dominanzgeste des Hundes sein, häufig ist das Verhalten jedoch lediglich Kontaktliegen des Hundes als Ausdruck eines Zusammengehörigkeitsgefühls.
Worauf ich hinauswill: In der Diskussion darüber, wer denn nun der Führer ist, ob es einen Alpha gibt oder nicht, woran man dominantes Verhalten am Hund erkennt, ob es überhaupt einen dominanten Hund gibt, etc., geistern die abstrusesten Vorstellungen durch die Köpfe. Der gesunde Menschenverstand bleibt hier außen vor.
Die Leidtragenden sind die Hunde, denn ihnen fehlt die Orientierung. Wir erhöhen sie aus Unwissenheit Tag für Tag in ihrer Position, so dass sie notwendigerweise als Chefs agieren und das wird dann mit großer Empörung quittiert: „So ein aggressiver Hund“. Jetzt sind die Züchter gefragt, „die müssen endlich aggressionsfreie Hunde züchten“. Der fehlgeleitete Hund wird entsorgt und wenn es dann noch eine rassespezifische Stiftung gibt, braucht man ja auch kein gar so schlechtes Gewissen zu haben, weil man ja zunächst seinen Hund nicht im Tierheim ablädt.
Woran erkennt man Dominanzprobleme?
Spätestens wenn der Besitzer vom Hund gebissen wird, dürfte ihm klar sein, dass er ein Problem mit seinem Hund hat. Anderen Besitzern wird dieses bereits klar, wenn der Hund nach ihnen in die Luft schnappt, ihnen die Zähne zeigt oder sie vielleicht sogar nur leise und verhalten anknurrt.
In der Regel wird erst bei offen aggressivem Verhalten des Hundes erkannt, dass etwas schief gelaufen ist. Doch das meiste offen aggressive Verhalten hat eine mehr oder weniger lange Vorgeschichte, in der der Hund schleichend gelernt hat seine erwachsenen menschlichen Rudelmitglieder nicht als ihm überlegen anzusehen. Der Hund registriert ein Machtvakuum und testet in vorsichtigen Schritten aus wie weit er sich hocharbeiten kann. Anfangs stellt er beim Spaziergang vielleicht nur plötzlich seine Ohren auf Durchzug. Obwohl keine große Ablenkung vorhanden ist, bequemt er sich erst nach mehrmaligem Rufen, zu seinem Besitzer zurückzukehren. Auf die Aufforderung, seinen Popo von der Haustür wegzubewegen macht er einen auf tief schlafend. Er grummelt beim Fressen vor sich hin, wenn sein Besitzer die Frechheit besitzt sich ebenfalls in der Küche aufzuhalten. Bei der Fellpflege versucht er ständig sich zu entwinden, bekommt er mit, dass er gebadet werden soll, zieht er sich unter das Sofa und antwortet auf alles Locken nur mit Drohgeknurre.
Die Anfangsstadien der schleichenden Machtübernahme des Hundes verlaufen meist so harmlos, dass den Besitzern nichts auffällt, oder sie das, was ihnen auffällt, als nicht weiter schlimm betrachten. Doch ehe sie sich versehen erobert sich der Hund immer mehr Nischen und setzt seinen Menschen Verbote. Diese spricht er zunächst nur durch Knurren, dann durch Schnappen und schließlich durch Beißen aus. Die Besitzer sind vom ersten offensichtlich aggressiven Anzeichen ihres Hundes so überrascht, dass sie, teils aus Überrumpelung, teils aus Angst, instinktiv zurückweichen, womit der Hund für sich positiv gepunktet hat: Sein Verhalten war erfolgreich, also wird er es wieder probieren.
Die wenigsten Hundebesitzer sind so reaktionsschnell und beherzt den Hund entweder sofort mit drohenden Blicken, tiefer, energischer Stimme am Nacken zu packen oder auf den Rücken zu werfen und dort niederzudrücken, bis sich der Hund ergibt. Genau diese Reaktion auf den ersten aggressiven Versuch des Hundes würde jedoch häufig den letzten Versuch des Hundes bedeuten - er traut sich nie wieder.
Dominant veranlagte Hunde, insbesondere in der Pubertät und insbesondere Rüden, werden die Cheffrage jedoch auch trotz dieser Maßnahme noch häufiger stellen.
Anzeichen für Dominanzprobleme können sein:
- anknurren
- Zähne fletschen
- in die Luft schnappen
- beißen, wenn dem Hund irgendetwas nicht passt (z.B. körperliche Nähe, angefasst werden, beim Fressen gestört zu werden, einen Leinenruck zu bekommen, in der Ausbildung unter Einsatz der Hände seines Besitzers körperlich korrigiert zu werden, Fellpflege)
- das Nichtbefolgen von Befehlen
- das nur zögerliche und unkorrekte Ausführen von Befehlen
- das Sträuben gegen ein Auf-den-Rücken-drehen
- das Sträuben auch nur irgendwie festgehalten zu werden
- das ständige Zerren an der Leine
- die Weigerung, den Platz zu verlassen, an dem der Hund gerade liegt
- das Vorpreschen durch Türen, Gänge, Treppen hinauf und hinunter
- das aggressive Verhalten gegenüber anderen Hunden
- das nachdrückliche Einfordern von Aufmerksamkeit
- die Besetzung strategisch wichtiger Plätze in der Wohnung, z.B. Flur, Treppenabsatz
- das Bestreben möglichst auf erhöhten Liegeflächen zu legen wie Sofa, Bett, Küchenbank, etc.
- bei Rüden: ständiges Markieren
- das Nichtauslassen von Gegenständen
- das Berammeln von Menschen
- das morgendliche Ignorieren des Besitzers oder das Ignorieren desselben, wenn dieser nach Hause kommt
Wohlgemerkt: dies können Anzeichen für dafür sein, dass der Hund von sich glaubt, eine hohe Stellung zu besitzen, müssen es aber nicht notwendig sein!
Dominanz äußert sich nicht nur aktiv in eher aggressivem Verhalten, sondern auch in passiver Dominanz: Auf die Anweisung hin den Fernsehsessel zu räumen, dreht sich der Hund wohlig brummelnd auf den Rücken und verlangt Steicheleinheiten am Bauch. Beim Spaziergang kommt er zwar auf Zuruf zurückgelaufen, dreht aber zunächst noch einige Kapriolen um den Besitzer. Wird von ihm ein Platz verlangt, rettet er sich mit drolligem Pfötchengeben. Soll er still liegen, schnappt er sich nach kurzer Zeit ein Spielzeug und bringt es wedelnd seinem Besitzer, etc. Solche Hunde bringen ihre Besitzer zwar meist nicht in Gefahr, weil sie sich nicht aggressiv verhalten, aber erzieherische Bemühungen fruchten kaum etwas. Als lustige, häufig temperamentvolle Hunde bestimmen sie mit Charme, wo es im Familienrudel langgeht. Die Besitzer sind sich dessen entweder nicht bewusst oder belächeln es. Dabei wird jedoch erstens vergessen, dass Erziehung und Gehorsam für den Hund lebensrettend sein kann und dass zweitens auch solche passiv dominanten Hunde in aktiv dominante, offen aggressive umschlagen können.
Wie kann man es nun richtig machen?
1. Die Züchter sind gefragt - aber nicht, indem sie „aggressionsfreie“ Hunde züchten (eine perverse Idee), sondern indem sie Welpeninteressenten über typische Merkmale der Rasse Briard aufklären - und nicht nur über die wünschenswerten, tollen Merkmale, sondern auch über die, die zu Problemen führen können. Das Dominanzstreben erwachsen werdender Briard´s, vor allem der Rüden gegenüber ihren Menschen, aber auch gegenüber ihren Artgenossen muss dabei offen besprochen werden.
2. Die Züchter sind nochmals gefragt - indem sie nämlich genau hinschauen, ob jemand überhaupt Briard-geeignet ist und außerdem, wer zu welchem Welpen passt. Jeder verantwortungsvolle Züchter, der seine Welpen den ganzen Tag über begleitet, sieht sehr schnell, welcher von seinen Welpen größere expansive Bestrebungen zeigt. Nicht nur muss er als Züchter schon in den ersten 8 Wochen reglementierend eingreifen, sondern er muss genau schauen, wem er diesen Hund anvertrauen kann - und wem eben nicht.
3. Die Hundebesitzer in spe sind gefragt - sich genau über die Rasse zu informieren und sich selbstkritisch zu fragen, ob man es nicht vielleicht mit einer Rasse probiert, die weniger Probleme in Sachen Einordnung bereitet, wie z.B. einem Kurzhaarcollie.
Ist sich der Interessent dessen voll bewusst, für welche Rasse er sich entscheidet, wenn er einen Briard kaufen will und ist der Züchter der Meinung einen guten Welpenkäufer gefunden zu haben, geht die Arbeit weiter:
Einordnung im Welpenalter
Jetzt heißt es, den Hund von Welpenbeinen an richtig einzuordnen - und nicht erst mit Bemühungen anzufangen, wenn einem der Kleine plötzlich auf dem Kopf herumtanzt oder gar schon die Zähne zeigt.
Das Verrückte an der ganzen Situation ist, dass es eigentlich so einfach ist einem Hund zu zeigen, dass er unter den erwachsenen Familienmitgliedern steht. Man braucht gar nicht viel Zeit, die man zusätzlich investieren muss, man braucht auch keinen Hundeverein oder eine Hundeschule, alles was man braucht ist die Kenntnis darüber, wie sich ein Hundeboss in einem Rudel verhält - und das gilt es zu imitieren.
Und das heißt:
Hundebesitzer müssen Autorität ausüben wollen und können. Antiautoritäre Erziehung hat nichts mit besonderer Liebe zu tun, sondern sie ist wider die Natur des Hundes.
Nun meinen sehr viele Hundebesitzer, sie könnten Autorität über ihren Hund nur durch (körperliche) Härte erlangen. Doch das ist ein Irrglauben. Sie können damit dem Hund zwar Angst einjagen, doch das heißt noch lange nicht, dass er seinen Menschen als Autorität akzeptiert. Autorität gewinnt man durch einen kontrollierten Umgang mit dem Hund, durch das Setzen von Regeln und dem konsequenten Bestehen auf Einhaltung dieser Regeln, durch die Vermittlung von Ruhe und Überlegenheit in jeder Lebenssituation, durch die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, die der Hund immer dann hat, wenn er in Kooperation mit seinem Menschen agiert.
Wichtig ist auch ein vorausschauendes Denken: Hundebesitzer müssen sich angewöhnen, die Zeichen des Hundes so schnell zu entschlüsseln, dass sie ihm immer einen Schritt voraus sind. Der Hund erlebt seinen Menschen so als einen Allwissenden, den man nicht austricksen kann.
Im Grunde genommen braucht man sich nur einen Satz zu merken: Der Chef agiert, die anderen reagieren. Auf die Beziehung zum Hund übertragen heißt das: Man selbst bestimmt, wann gespielt, mit was gespielt, wie lange gespielt, wann und wie lange und wo geschmust wird. Man selbst bestimmt, wann man zum Spaziergang aufbricht, wie man sich auf dem Spaziergang beschäftigt, in welche Richtung man an einer Kreuzung abbiegt. Nicht man selbst gibt auf dem Gang dem Hund ständig Signale, indem man stehen bleibt, zurückgeht, eine andere Richtung einschlägt, sondern der Hund muss lernen sich selbstständig am Besitzer zu orientieren. Nicht der Mensch stürzt morgens nach dem Aufwachen zu seinem Hund und begrüßt ihn, gleiches gilt für das Nachhausekommen.
Der Mensch hat Zugang zu allen Ressourcen, kann essen, wann und was er mag, liegen wo und wie lange er mag, sich mit anderen Rudelmitgliedern beschäftigen, wann und wie er es mag. Dem Hund werden keine Privilegien zugestanden, die ihn auf falsche Gedanken bringen könnten: Er darf zeitlich nicht vor seinen Menschen fressen und sollte sich sein Futter erarbeiten, statt es nur vor die Nase gestellt zu bekommen. Er bekommt auch nichts von den Mahlzeiten seiner Menschen am Tisch ab. Er darf nicht an solchen Stellen des Hauses seinen Lieblingsplatz aufschlagen, wo er alles im Blick hat. Er hat auf Aufforderung seinen Platz zu räumen.
Geistig-seelische Führung ist die eine Seite, aber man darf auch nicht verhehlen, dass es durchaus auch darauf ankommen kann, dem Hund auch körperlich gewachsen zu sein. Das allein kann bei bestimmten Kombinationen wie „zarte Frau - bulliger Briardrüde“ schon kompliziert werden. Denn ein Hund, der seinen Menschen mühelos an der Leine hinter sich herschleift, ihn jedes Mal von den Beinen holt, wenn ein Kaninchen auftaucht oder sich einfach stur weigert seine 45 Kilo von der Haustür wegzubewegen, kann natürlich dazu tendieren seinen Menschen nicht so ganz für voll zu nehmen.
Körperliche Reglementierung?
Nun sind wir auch beim Thema körperliche Reglementierung angelangt. Sie ist - gerade beim Briard - in der Regel nie gänzlich zu vermeiden, ist meist schon bei den Welpen nötig. Wie diszipliniert ein Führungshund? Er diszipliniert seine Untergegebenen durch Anstarren, starre Körperhaltung, Drohknurren, Griff über den Fang, Packen im Nackenfell, Niederdrücken auf den Boden. Das geht ratzfatz im Sinne eines Überraschungsangriffs - und wird dementsprechend dosiert, wie aufmüpfig der Hund ist. So, und das kommt eben auch auf uns als Briardbesitzer zu - in der Regel. Natürlich geht es den meisten Menschen so, dass sie ihren Hund allein verbal kontrollieren wollen und dahin geht ja auch das Ziel der Erziehung. Aber auf diesem Weg zum Ziel, bei dem nur noch ein Blick reicht um den Hund von einer neuen „Schandtat“ abzubringen“, bedarf es einfach ab und zu körperlicher Reglementierung - auch wenn ein solcher Satz heute geradezu verpönt ist. Diese Reglementierung besteht aber nicht im Aufhängen am Stachelhalsband, im Tritt in die Seite, dem Umdrehen der Hoden oder einer gezielten „Kopfnuss“, sondern in einer der Hundesprache angemessenen Form. Natürlich kann ich einem Hund mittels Tritten Schmerzen zufügen und ihm damit klarmachen, dass ihm diese Schmerzen wieder drohen, sollte er das unerwünschte Verhalten nochmals zeigen. Aber als Geste eines überlegenen Tieres begreift der Hund die oben genannten Maßnahmen wie den Schnauzgriff. Und wer seine erwachsenen Hunde beim Reglementieren der eigenen Welpen beobachtet, weiß es genauso wie aufmerksame Beobachter von Geschehen in Hundegruppen: Diese Formen der Reglementierung werden verstanden, führen nicht zum Vertrauensverlust, man benimmt sich hinterher ganz normal, keiner der Beteiligten ist nachtragend etc.
Bei Miniwelpen, die sich beispielsweise das Angefasst- und auf den Arm genommen werden, während sie doch eigentlich viel lieber mit einem Kumpel spielen oder einen Puschen zerlegen wollen, sofort mittel Einsatz ihrer Beißerchen verbieten wollen, reicht - leider - in der Regel kein Anstarren aus. Böses Grummeln, ein Schnauzgriff oder Nackenstubs nach unten sind viel effektiver - und die Probleme fangen so erst gar nicht an.
Briards in der Welpenspielstunde
Minibriards in der Welpenspielstunde zeigen erstaunliches Wehrhaftigkeitsverhalten, wenn ihnen etwa nicht passt - und agieren gerne gleich mit Lefzenhochziehen, Attacke nach vorn, Zubiss. Ist der Welpe deswegen verhaltensgestört - natürlich nicht!!! Der zeigt Testverhalten. Ihm passt was nicht, er artikuliert das auf seine Hundeweise - und wir sollte ihn nun eben im wahrsten Sinne des Wortes ratzfatz auf den Boden der Tatsachen zurückholen: „Mich als Chef knurrst du nicht nochmals an und geschnappt wird schon gar nicht“. Welpenbesitzer stehen dann erstaunt und erschrocken da, sehen ihr schreiendes „Baby“, das sich kurz nach der Reglementierung mittels Anstarren, verbalem Anschiss und Niederdrücken durch den Übungsleiter schon wieder begeistert ins Vergnügen stürzt und von da an besonders gerne zum Übungsleiter geht, ihn begeistert begrüßt, sich gern bei ihm aufhält - obwohl dieser „schlimme“ Mensch ihn so heftig angefahren und mal kurz auch noch auf den Boden gedrückt hat - und nicht nur das, er hat ihn auch noch da gehalten, bis das Strampeln aufhörte.
Ich persönlich finde es immer wieder erschreckend, wie die Welpen sich an mich als Übungsleiter in einer Spielstunde anschließen, bei mir Sicherheit suchen, wenn es z.B. darum geht über einen bedrohlich schwankenden Steg zugehen - Sicherheit, die der eigene Mensch (noch) nicht gibt. Solche Welpen lassen sich im dicksten Getümmel fortan verbal reglementieren, während der eigene Halter es nicht einmal geregelt bekommt seinen Welpen unter Kontrolle zu halten, wenn er ihn an der Leine hat. Woran liegt das wohl? Ich denke, dass gerade Briardwelpen sehr schnell merken, dass in so einer Gruppe klare Regeln herrschen, dass sie genau merken, wer hier die Regeln aufstellt, ohne selbst schon davon betroffen gewesen zu sein. Und wenn sie dann auch noch selbst direkt reglementiert werden, ist alles klar: Das ist die Chefin, mit der macht alles irre Spaß, da habe ich tolle Erfolgserlebnisse auf dem Abenteuerparcours, etc. Die Welpen sind nicht eingeschüchtert, sondern voller Freude und Vertrauen.
Dieses Verhalten zeigen jene Welpen umso mehr, bei denen man bei Beobachtung der Interaktion mit ihren Besitzern oder auch bei Gesprächen schnell heraushört, dass diese ihren Hund eben nicht einordnen, sondern ihn in einem Vakuum lassen.
Für mich ist nach Bekanntschaft mit annähernd 1000 Welpen eines völlig klar: Bereits der kleine Welpe sucht einen festen Orientierungspunkt, eine verlässliche Person, die ihn nicht nur füttert und mit ihm spazieren geht, sondern die ihm die Dinge des Lebens zeigt, ihm ein Gerüst aus festen Grenzen schneidert, innerhalb derer er Freiheiten genießen kann. Eine Person, die auch über ihn lachen kann, ihm mal Frechheiten zugestehen kann, dosiert eingreift, nicht immer nur nach dem Motto verfährt: Daumen drauf. Briards erscheinen mir da ganz besonders sensibel und quittieren schnell die Schwächen ihrer Besitzer.
Erziehungskurse und Hundesport als Lösung?
Was beim Welpen versäumt wurde, wird nicht besser. Im Gegenteil: Irgendwann kommt der junge Hund nicht mehr so brav auf Zuruf, erweitert seinen Aktionsradius, interessiert sich mehr für andere Hunde als für seine Besitzer. Das Zerren an der Leine hat er zwar schon immer gemacht, aber jetzt tut es richtig weh, weil er so schwer geworden ist!
Tja, und dann kommt der Gedanke, man müsse vielleicht doch einmal einen Erziehungskurs besuchen?
Und hier geht der nächste Irrglauben los: Das Beibringen von Leinenführigkeit, Sitz, Platz, Bleib, etc. soll genauso wie ein super Verfolgen einer Fährte oder ein fehlerfreier Flug über den Agilityparcours notwendigerweise ein Beleg für eine funktionierende Rangordnungsbeziehung sein.
Klar: Ein Hund, der seinen Menschen als Chef akzeptiert, wird Befehle, sofern sie ihm gut beigebracht worden sind und er sie auch wirklich versteht, ausführen. Umgekehrt wird aber kein Schuh daraus: Nur weil ein Hund Befehle ausführt, heißt das noch lange nicht, dass er seinen Chef als Chef akzeptiert! - Wieso? Hier kommt das Thema Motivation ins Spiel: Warum sollte sich ein Hund dagegen wehren, auf Befehl mit über den Parcours zu rennen, wenn ihm kaum etwas mehr Spaß bereitet? Warum soll er einen Platzbefehl verweigern, wenn es ihm einfach egal ist, ob er nun steht, sitzt oder liegt?
Wie weit ein Hund seinen Menschen wirklich als Chef akzeptiert, sieht man dann, wenn er Befehle erhält, die seinen inneren Bedürfnislagen entgegenstehen: Er liebt beispielsweise andere Hunde und will unbedingt schnell hin - lässt er sich auf entsprechenden Befehl hin an lockerer Leine weiter führen oder nicht? Er liebt Wasser, darf aber wegen einer Blasenentzündung heute mal nicht hinein - lässt er sich zurückrufen oder nicht? Er sitzt voller Begeisterung im Auto, sieht bereits, dass die Fahrt zu seinem beliebten Spazierweg geführt hat, freut sich wie ein Irrer aufs anstehende Toben und Rennen, will endlich raus - wartet er auf entsprechenden Befehl hin ruhig bei geöffneter Klappe die Erlaubnis ab, oder stürzt er hinaus?
Worauf ich hinauswill: Gerade weil wir - Gott sei Dank - in der Ausbildung über Motivation arbeiten, ist das tolle Laufen eines BH-Schemas oder ein super Revieren nicht unbedingt der Tatsache zu verdanken, dass wir unseren Hund von unserer Chefposition überzeugen konnten, sondern u.U. allein der Tatsache, dass der Hund gelernt hat mit uns zusammen Spaß haben zu können.
Natürlich ist das auf der einen Seite vollkommen in Ordnung. Mensch und Hund arbeiten zusammen, haben beide ihren Spaß, das stärkt die Bindung - und kann auch die Rangordnung stabilisieren, aber es ist nicht automatisch ein Garant für eine funktionierende Einordnung des Hundes! Es ist keine große Leistung, einen Hund dazu zu bewegen etwas zu tun, das er sowieso gern macht und auch nicht etwas zu unterlassen, das ihm eh nicht wichtig ist. Ihn von etwas abbringen, das seine Leidenschaft ist, bzw. ihm etwas abzuverlangen, das er eigentlich blöde findet - das erfordert die „Einsicht“ des Hundes, dass er eben tun muss, was der Chef von ihm will.
Hunde haben damit kein Problem - ihre Menschen machen eins daraus. Weil sie meinen, partnerschaftlicher Umgang bedeute, man gehe gleichberechtigt miteinander um. Es gibt Hundetrainer, die ihren Kunden allen Ernstes einbläuen, dass sie als Hundehalter eben missverständlich kommunizierten, wenn ihr Hund sich gerade mal nichts ins Platz legen will. Doch aus der Erkenntnis als Trainer, dass viele Hundehalter tatsächlich so abstrus mit ihrem Hund kommunizieren, dass der gar nicht wissen kann, was er eigentlich machen soll, kann nicht die These abgeleitet werden, es handle sich per se immer nur um Missverständnisse. Häufig handelt es sich um Austesten: Beharrt der Alte jetzt darauf, dass ich tue, was er will oder nicht. Der Besitzer hat es im Alltag versäumt dem Hund klar zu machen, dass letztlich er als Mensch die Entscheidung trifft.
Der Unterschied zwischen Beibringen und Abverlangen
Leider wird in der modernen Hundeerziehung häufig ein gravierender Fehler begangen:
Die erste Stufe stimmt noch: Man bringt dem Hund über motivierende Erziehung etwas bei, so dass er versteht, was man von ihm möchte - sei es das Verbleiben im Platz, das Apportieren eines Gegenstandes, das Einfädeln in den Slalom, das Auslassen von unerlaubten Gegenständen.<
Doch die zweite Stufe wird nicht in Angriff genommen: Das Aberverlangen des Gelernten. Macht der Hund auch beim dritten verbalen Zeichen noch kein Platz, geht die Hand in die Leckertasche, bewegt sich zu Boden – et voilà, der Hund liegt im Platz. Hat er hiermit einen Befehl befolgt und wird dafür mit einem Leckerchen belohnt? Nein, er trainiert seinen Menschen darauf, bitteschön immer ein Lecker auf den Boden zu legen, bevor der Hund sich legen soll. Den Hund dagegen nach der zweiten, wohlgemerkt freundlichen Aufforderung mit den Händen ins Platz zu legen - das grenze ja schon gleich wieder an körperliche Gewalt ist und sei daher prinzipiell abzulehnen. Was lernt der Hund?: „Ob ich Befehle befolge, entscheide letztlich ich.“
Insofern kann auch die Teilnahme an einem Erziehungskurs die Mensch-Hund-Beziehung nicht nur nicht verbessern, sondern gar verschlechtern, denn:
1. Der Hundehalter glaubt ernsthaft, er widme sich ja jetzt der Erziehung des Hundes auf dem Hundeplatz, macht vielleicht auch noch die Hausaufgaben. Aber ansonsten bleibt alles beim Alten.
2. Wenn der Hundehalter richtig Pech hat, gerät er an Vertreter der modernen Kuschelstrategie: „Dein Hund macht nicht Platz - dann hast du ihn wohl nicht richtig motiviert?“ Der Hund lernt, seine Menschen nicht ernst zu nehmen und zu manipulieren.
Dann wird er geschlechtsreif, er reift langsam zum Erwachsenen, hat eine Biographie hinter sich, in der ihm ständig Dinge zugestanden worden sind, die eigentlich nur dem Chef zustehen und mit Menschen gelebt, die keine Führungsqualitäten haben. Er zieht die Konsequenz, macht, wozu er Lust hat. Oft merkt noch immer keiner etwas, wenn das, wozu der Hund Lust hat, nicht so sehr den Interessen seiner Menschen widerspricht. Aber dann kommt der Tag, an dem der Mensch etwas will, was der Hund absolut nicht will: Er soll z.B. aus dem Weg gehen, weil sein Mensch dieses Mal ein Tablett mit lauter Gläsern darauf hat und sich das ansonsten übliche Umkurven des Hundes, den man ja nicht stören will, nicht zutraut. Der Hund reagiert auf Ansprache nicht, wird leicht mit dem Fuß angestupst, damit er endlich aufsteht. War dem Hund in diesem Moment seine Ruhe aber wichtig, fühlt er sich extrem gestört, so wird er seinen Menschen zumindest anknurren, denn das Verhalten, das der Mensch gezeigt hat, geziemt einem Untergebenen nicht. Und als solchen nimmt der Hund seinen Menschen wahr. Der Hund handelt sachlogisch konsequent - der Mensch ist hier der Versager.
Und wie geht die Geschichte aus? Man gibt diesen Hund ab - und holt sich den nächsten, vielleicht von einem anderen Züchter, „der nicht so aggressive Hunde züchtet“! Selbsteinsicht gleich Null.
Der Leidtragende ist der Hund - ich brauche wohl kaum einem Briardbesitzer erzählen, wie sensibel diese Hunde sind, wie stark sie sich auf ihre Familie fixieren!
Über falsch verstandene Dominanzprobleme
So wichtig es ist, als Hundehalter die Rangordnung im Familienrudel stets zu beobachten und unter Kontrolle zu halten, so bedeutet dies jedoch nicht, in jedem Problem mit dem Hund gleich ein Dominanzproblem zu sehen.
Nicht jeder Hund, der seinen Besitzer anknurrt, tut dieses um ihn zu dominieren. Häufig ist der Hund durch das Verhalten seines Besitzers verstört, verängstigt, fühlt sich in die Ecke getrieben und knurrt, schnappt, beißt aus einer Abwehr heraus, weil er das Gefühl hat sich verteidigen zu müssen. In dieser Situation mit der körperlichen Unterwerfung des Hundes zu reagieren, weil man meint, man habe ein Dominanzproblemen, macht die Sache nur schlimmer.
Nicht jede Form des Ungehorsams bedeutet, dass ein Hund seinen Besitzer nicht als Boss respektiert. Zwar ist es sicherlich richtig, dass man einen jagenden Hund wenn überhaupt nur qua eigener Dominanz und äußerst konsequenter Erziehung davon abbringen kann, doch generell gilt doch eher der Fall, dass der Jagdtrieb mit dem Hund durchgeht. Ein Hund, der aus Panik vor Autos wie wild an der Leine zerrt um von der Straße wegzukommen, stellt damit nicht primär das Recht seines Halters in Frage den Spazierweg bestimmen zu können, sondern er ist von seiner Angst so bestimmt, dass für ihn in dem Moment nur noch die Angst zählt und sonst gar nichts. Ein Hund, der auf Grund mangelnder Sozialisation mit anderen Hunden im Welpenalter ein gestörtes Verhältnis zu seinen Artgenossen entwickelt hat und diese nur noch „fressen“ will, kann zwar nur durch die Dominanz seines Besitzers unter Kontrolle gebracht werden, doch muss seine Aggression gegenüber den Artgenossen nicht ein Infragestellen der Position des Besitzers bedeuten. Ein Hund, der an der Leine zieht, ist nicht automatisch ein schlechter untergeordneter Hund als einer, der nicht an der Leine zieht.
Einzelne Verhaltensweisen allein bestimmen nicht, wie der Hund seine Rangposition einschätzt, sondern die Gesamtheit seiner Verhaltensweisen. Schnellschüsse im Hinblick auf ein angebliches Dominanzproblem helfen ebenso wenig wie die Verleugnung eines solchen. Hier hilft häufig tatsächlich nur der geschulte Blick eines guten Hundeerziehers, der unterscheiden kann, ob es sich um ein Dominanzproblem handelt oder um etwas anders. Denn eines ist beim Briard offensichtlich: Einerseits tendiert er zwar deutlich zu dominantem Verhalten, andererseits ist es aber auch typisch für ihn bei wahrgenommener Bedrohung eher nach vorne zu gehen als die Flucht zu ergreifen. Der unerfahrene Besitzer sieht beide Male nur einen knurrenden und schnappenden Briard.
Fazit:
Es bleibt dabei: Einen Hund abgeben zu müssen, weil man an einem Punkt angekommen ist, an dem man erkennen muss, dass man Angst hat vor ihm, dass alle Familienmitglieder bestimmte vom Hund diktierte Regeln einhalten müssen, damit es nicht zu einer Eskalation innerhalb der Familie kommt, weil man einsehen muss, dass man in der Konfrontation mit anderen Menschen oder anderen Hunden keine Kontrolle mehr über den eigenen Hund hat - all das ist ein Armutszeugnis für den Besitzer, nicht für den Hund. So einen Hund einzuschläfern ist ein Verbrechen. Es gibt nur ganz, ganz selten organische Ursachen für Aggressionsverhalten beim Hund, in der Regel sind Bissvorfälle auf falsches Verhalten des Menschen zurückzuführen.
Ich kann nur die Arbeit unser „Briard in Not“ Beauftragten bewundern, die mit all diesem Mist konfrontiert werden. Menschen, die sich bewusst für einen Briard in Not entscheiden, ihm eine zweite Chance geben, kann ich nur Mut machen. Gerade bei Rangordnungsproblemen ist Hopfen und Malz nicht verloren - man kann so vieles tun um das wieder gerade zu biegen, bzw. in der neuen Beziehung erst gar nicht aufkommen zu lassen. Der Briard kapiert sofort, mit wem er es zu tun hat und wird sich - häufig zutiefst beglückt über das Finden eines souveränen Führers - gerne in seine neue Familie einordnen, wenn diese es richtig anstellt.
Viel Lärm um nichts
oder doch?
Wir müssen ehrlich sein, es gibt streitsüchtige Hunde, die keine Gelegenheit auslassen, eine Rempelei anzuzetteln. Bei einigen Rassen findet sich dies häufiger, bei anderen weniger. Eine unangenehme Situation sind Raufereien allemal.
Es gibt die verschiedensten Ursachen, wenn es bei Hundebegegnungen aus heiterem Himmel zu hässlichen Raufereien kommt - ohne dass die Hundebesitzer falsch reagiert hätten. Es gibt wirklich Hund, die ohne ersichtlichen Grund auf Artgenossen aggressiv reagieren. Häufig Rüden gegen Rüden. Aber auch Hündinnen sind keine Engel und können mit erheblicher Energie andern «an den Karren fahren». Jeder Hundehalter nimmt solche Ereignisse auf seine Art wahr. Natürlich ist es schwer oder fast unmöglich, als beteiligte Partei objektiv zu bleiben. Wo fängt eigentlich die Rauferei an? Wo der ernsthafte Kampf? Die Grenzen sind gleitend. Schon eine kleine Rauferei kann zu erheblichen Verletzungen führen, zum Beispiel an den Augen.
Ein echter Kampf hingegen kann relativ glimpflich ablaufen, wenn zwei Rüden zupacken und vielleicht nur oberflächliche Bisswunden davon tragen, die rasch verheilen. Der Schein kann aber auch trügen. Wenn die Hundehalter nach einer Beißerei die Hunde auf Verletzungen hin kontrollieren und lediglich ein paar Löcher von den Zähnen des Gegners registrieren, heißt das noch gar nichts. Solche Wunden bluten fast nicht, können aber sehr tief sein und nach einigen Tagen eitern; der Hund bekommt Schmerzen und Fieber, die Infektion ist perfekt. Daher sollte man auch scheinbar kleinen Wunden Beachtung schenken.
Oft hört man, die Schärfe komme vom Hundesport. Diese Annahme ist gänzlich falsch. Hundesport macht Hunde nicht böse auf Artgenossen. Im Gegenteil, sie lernen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, auch unter Ablenkung durch andere Hunde, und werden so auch in der Freizeit bei Begegnungen mit Artgenossen sicher in der Hand des Führers sein.
Es gibt auch Hunde des übernervösen Typs, die bei jeder Gelegenheit kopflos reagieren und unberechenbar werden können. Zudem kann es dort, wo Rivalität ins Spiel kommt, wenn Hunde sich treffen, zu schweren Verletzungen kommen. Es ist ganz klar festzuhalten, dass es auch Kämpfertypen gibt, die nicht klein beigeben, auch wenn sie psychisch unterlegen sind, und bis zuletzt weiterkämpfen. In Situationen, die so unglücklich verlaufen, dass das ganze wohl-geordnete lnstinktgefüge zusammenbricht, kann es leider Hundekämpfe geben, die tödlich enden. Daher stimmt die landläufige Vorstellung nur ganz bedingt, wenn man gemeinhin annimmt, die Hunde sollen ihre Rangkämpfe ruhig selber austragen, in der Annahme, das hierarchische Gefüge sei dann hergestellt und es herrsche Ordnung bis ans Ende der Zeit.
Vorbeugen ist besser als heilen
Wie kann man einer Rauferei vorbeugen? Zwei große, selbstständige und selbstbewusste Hunde gleichen Geschlechts sollte man nicht zur gleichen Zeit frei im Gelände laufen lassen, auch wenn sie als gutartig gelten. Von einer Sekunde auf die andere kann die Situation eskalieren, denn Ursache für einen Streit entsteht rasch. Die Hundehalter sollten Vorsicht walten lassen, wenn die Hunde nicht aneinander gewöhnt sind.
Wenn es zu bedauerlichen Zwischenfällen kommt, ist der Gedanke, der oder die Hunde hätten ein gestörtes Instinktverhalten, kurzsichtig. Aggression, Führungsanspruch und Revierverteidigung können ohne weiteres positive Instinkte sein. Es liegt am WeIpenbesitzer, in der Erziehung und Ausbildung schon ganz früh diese Instinkte in geordnete Bahnen zu lenken, die kontrollierbar sind.
Die viel zitierte Unterwerfungsgeste des Unterlegenen führt bei weitem nicht immer zur Beschwichtigung des Siegers, im Gegenteil, sie kann ihn herausfordern, erst recht zuzupacken. Man sieht aber oft Vertreter kleiner Rassen, die sich so selbstsicher und imposant ihren Gegnern stellen, dass diese von ihnen ablassen oder eben gar nicht anfangen.
Nicht selten erklären Besitzer notorischer Raufer treuherzig: «Das hat er aber noch nie gemacht.. . » Es sind oft Hundebesitzer, die sich vielleicht unbewusst sogar freuen, wenn ihr «Rex» wieder einmal ein «BärIi» am Kragen nimmt. Sie reden sich dann heraus, Kraftproben seien ein Stück Natur. Das geht solange, bis zwei unerbittliche Kämpfer aufeinander stoßen. Also Grund genug, ihrem Hund das Angreifen strikte zu verbieten und notfalls drastisch zu korrigieren.
Zum Glück handelt es sich bei den meisten Auseinandersetzungen zwischen Hunden nur um herzhafte Balgereien, bei denen keiner der Kämpfer die Absicht hat, den anderen ernsthaft zu verletzen. Auch wenn das Ganze mit wildem Krach und Gebell über die Bühne geht.
Unerfahrene oder nervöse Zuschauer kann dieses Spektakel natürlich schockieren. Wenn man nachher nachschaut, findet man meist kaum einen Kratzer bei den Raufbolden. Hier kann man sagen, es war mehr Show als etwas anderes. Aber wie dem auch sei, auch da haben die Besitzer ihren Hunden klar zu machen, dass das Anzetteln solcher Spiele untersagt ist. Kämpfe werden häufig von unsicheren Hunden begonnen, die dann plötzlich Angst vor ihrem eigenen Mut bekommen. Selbstbewusste, ruhige Hunde lassen sich meist gar nicht auf solche Attacken ein. Das liegt nicht am fehlenden Kampf- oder Wehrtrieb, wie oft gespottet wird, sondern ist im Gegenteil ein Zeichen für absolute Sicherheit der Hundepersönlichkeit.
Deshalb ist es schon in den Welpenspielstunden von Bedeutung, dass die Jungtiere Gelegenheit haben, im Kampfspiel entsprechende Körpersignale zu erfassen und zu üben. So lernen sie auch, ernsthafte Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die meisten wirklich schweren Kämpfe brechen aus, weil einer der beteiligten Kontrahenten die Signale des andern nicht richtig interpretieren konnte und aus Unsicherheit die Nerven verlor.
Nicht eingreifen ist schwer
Hundekämpfe sind ein Albtraum für die meisten Hundehalter. Mit Recht. Unser Beschützerinstinkt kann uns verleiten, selber in den Kampf einzugreifen, weil wir unseren Hund vor Verletzungen bewahren wollen. Es braucht viel Überwindung, nicht einzugreifen. Aber die Situation kann sich auch so entwickeln, dass der erfahrene Hundehalter erkennt, dass es nun hart auf hart geht. Dann wird er nicht untätig daneben stehen und zuschauen, wie sein Hund unter die Räder kommt. Er begibt sich ohne zu Überlegen selber in Gefahr.
Es gibt verschiedene Methoden, die empfohlen werden, um kämpfende Hunde zu trennen. Keine taugt etwas, wenn man zu langsam, zu unsicher oder zu zögernd ist. Es gibt auch keinen richtigen Moment. Es geht höchstens, wenn beide Hundebesitzer ruhig bleiben, die ineinander verbissenen Hunde nicht auseinander zerren (viele schwere Verletzungen entstehen erst dann), sondern die Nerven behalten, bis die beiden Raufer Luft holen müssen, um sie dann gleichzeitig auseinander zunehmen. Jeder Hund wird sofort weggeführt, erst dann untersucht niemals gelobt und auch nicht getröstet. Wenn möglich die Wunden austupfen, um sich ein Bild von den Verletzungen zu machen. Unbedingt sollte man nach der Adresse und Telefonnummer des anderen Hundebesitzers fragen. Nötigenfalls auch dessen Autonummer notieren. Hat der eigene Hund begonnen, dann wäre es nichts als Anstand, anderntags anzurufen, um sich über den Gesundheitszustand des Hundes zu erkundigen. Abklären, bei welchem Tierarzt der Hund behandelt worden ist und ob eine Haftpflicht- oder Unfallversicherung für den Hund besteht. So oder so, jede Rauferei ist eine zuviel. Hundeführer sollten vorausschauend handeln. Um mit dem Hund unliebsame Begegnungen zu vermeiden, lieber einmal einen Bogen schlagen oder einen anderen Spazierweg wählen. Es lohnt sich.
Panik vor Hunden
was tun?
Viele Menschen leiden unter einer unbegründeten Angst vor Hunden. Diese Angst schränkt auch ihre Lebensqualität ein. Was kann man tun?
Ein grosser Hund kommt Herrn M. entgegen. Schon wieder ist sie da, diese Angst. M. mag sich nicht erinnern, je schlechte Erfahrungen mit einem Hund gemacht zu haben. Trotzdem bricnung oder Betroffenheit und gehen mit ausgeprägten autonomen Veränderungen einher: Herzklopfen, Gefässveränderungen, Pupillenerweiterungen, Kälte- und Hitzeempfindungen, Zittern, Übelkeitsgefühle, Schweissausbrüche, gegebenenfalls auch Verlust der Schliessmuskelkontrolle, Veränderungen der Motorik, Erstarren (gelähmt vor Angst) oder Fluchtbewegungen können die Folgeht ihm der Angstschweiss aus, er muss die Strassenseite wechseln. Innerlich ist er mit sich, dem Hund, dem Hundehalter wütend: Wie kann ein grosser Mann wie er so panisch reagieren? Seine Angst hat auch bewirkt, dass er das Joggen aufgegeben hat. Jedes Mal diese Panik, wenn ein Hund in der Nähe ist. Jedes Mal diese Ohnmacht, Hund und Hundehalter ausgeliefert zu sein. Die Angst der Menschen hat viele Gesichter. In unzähligen Untersuchungen ist über Angst geschrieben und gesprochen worden. Angst ist denn auch ein ernst zu nehmendes Gefühl. Aber was ist Angst eigentlich?Definiert wird die Angst als (<allgemeine umfassende Bezeichnung für emotionale Erregungszustände, die auf die Wahrnehmung von Hinweisen, auf mehr oder weniger konkrete bzw. realistische Erwartungen oder allgemeine Vorstellungen physischer Gefährdung oder psychischer Bedrohung zurückgehen». Angstzustände äussern sich in Gefühlen der Span sein.Grundsätzlich werden in der Psychologie Angst und Furcht unterschieden. Wenn die Gefahrenquelle eindeutig zielgerichtet und lokalisierbar ist, so spricht die psychologische Terminologie von Furcht, beispielsweise die reale Furcht vor Hunden. Ist die Bedrohung hingegen ein Gefühl, das nicht genau definiert werden kann, wie Angst vor Verlust, vor engen Räumen, Flugangst, Angst vor der Zukunft, Existenzangst, so spricht die Psychologie von Angst. Eine Phobie wiederum ist ein unbeherrschbarer, irrationaler Angstzustand, der sich in heftigen Vermeidungsreaktionen äussert und sich sowohl auf bestimmte Gegenstände wie Schlangen, Spinnen, aber auch Hunden sowie auch auf Situationen (Klaustrophobie) bezieht. Einer Phobie liegt in der Regel keine Ursache zugrunde. Hier handelt es sich bereits um Angstneurosen. Menschen, die unter einer solchen Phobie leiden, wie beispielsweise einer Hundephobie, sind in ihrer Bewegungsfreiheit drastisch eingeschränkt. Sie wagen sich auf keinen Spaziergang und machen schon von weitem einen „Bogen“ oder suchen panikartig einen anderen Weg, wenn sie nur schon von weitem selbst einen harmlos aussehenden Hund erblicken. Da nützt es nichts zu rufen: «Bleiben Sie ruhig stehen, er macht nichts!» Für Hundehalter ist es kaum nachvollziehbar, dass man ihren Liebling derart fürchten könnte.
Verschiedene Ursachen
Die Ursachen von Angst und Furcht können verschieden sein. Jeder Mensch kann auf irgend ein Erlebnis in seiner Kindheit oder Jugend zurückblicken, das ihn mit Furcht oder Angst erfüllte. Deshalb ist anzunehmen, dass eine übertriebene Furcht vor Hunden auf ein eindrückliches Erlebnis in der Kindheit zurückzuführen ist. Andererseits könnte aber die Furcht vor Hunden im sozialen Umfeld der Familie zu finden sein. Beispielsweise, wenn Eltern Hunde absolut nicht mochten oder gar selbst Angst vor Hunden an den Tag legten. Auch kulturelle Hintergründe spielen eine Rolle, so galt beispielsweise im arabischen Raum und im Judentum ein Hund als schmutzig, da er seit Urzeiten als Unratvertilger herumlungerte oder als «böser» Bewacher gebraucht wurde. Selbst das Christentum übernahm einige der negativen Ansichten des Judaismus, allerdings wurde diese Haltung durch viele positiven Erzählungen und volkstümliche Überlieferungen stark gemildert. Häufiger wird der Hund im Christentum als treuer Begleiter angesehen, wie beispielsweise in der Legende aus der Bibel von «Tobit» und Tobias: Tobias, der seinem blinden Vater helfen will und für diesen als Schuldeneintreiber fungierte, war stets in Begleitung seines treuen Hundes «Tobit». In anderen Religionen, wie beispielsweise im Hinduismus, wurde der Hund verehrt, denn die Hindus waren der Ansicht, Hunde hätten einen siebten Sinn und vermochten in die Zukunft zu sehen. Wie dem auch sei, es ist müssig, der Furcht oder der Angst vor Hunden auf den Grund zu gehen. Tatsache ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die panische Angst vor Hunden haben, ohne zu wissen weshalb. Und dieser Tatsache gilt es Rechnung zu tragen! Vieles liegt also in den Händen von Hundebesitzern. Wie kein anderes Tier nehmen Hunde am gesellschaftlichen Leben der Menschen teil: Sie fahren mit in die Ferien, sie dürfen mit ins Hotel, in ein Restaurant, sie gehen mit Herrchen oder Frauchen in der Stadt spazieren, sie sind auch in Tram, Bus oder Zug anzutreffen. Es ist deshalb unumgänglich und gehört in jedes „Handbuch für Hundehalter“: Hundehalter müssen die Angst der Mitmenschen respektieren. Sie sollen ihren Hund deshalb stets unter Kontrolle haben und es nicht zulassen, dass er jenen Menschen nahe kommt, die Hunde nicht mögen oder Angst haben.
Korrektes Verhalten
Hundeerziehung ist das halbe Leben. Eine solide Erziehung ist bei jedem Hund angebracht, dringend empfohlen aber bei grösseren Rassen. Ein Hund, der gehorcht, macht das Leben einfacher, für den Besitzer wie auch für die Mitmenschen. Den Hundehassern keine Angriffsmöglichkeit geben! Jogger und Passanten werden vom Hund weder angebellt noch angesprungen, klappt das noch nicht, gehört der Hund an die Leine. Toleranz auf beiden Seiten walten lassen! Bei gesteigerter Hundeangst ist guter Rat teuer. Durch die vielen Medienberichte im Zusammenhang mit Unfällen mit Hunden stellt der Hund, im Gegensatz zu einer Maus- oder Spinnenphobie, ein echtes Gefahrenpotential dar. Deshalb ist es auch schwieriger, einen Menschen mit einer Hundephobie zu therapieren. Dennoch, es gibt Hilfe und sie sollte auch in Anspruch genommen werden, genau so, wie wir Hilfe suchen bei einem körperlichen Schmerz. Als erste Massnahme sei diesen Menschen geraten, bei der Begegnung mit einem Hund und Hundeführer ruhig und sachlich ihre Angst mitzuteilen. So kann der verantwortungsbewusste Hundehalter schnell und gezielt handeln.
Sich Respekt verschaffen, ruhig bleiben und selbstsicher stehen bleiben sind wirksamere Methoden als ängstlich umkehren, davonrennen, einen Stock in der Hand schwingen oder sich zu verstecken suchen. Pöbeln und sich beschimpfen bringen Aggressionen. Ein Hund merkt sehr schnell, wenn etwas nicht stimmt, was ihn erst recht aufmerksam macht. Ausserdem spürt ein Hund mit sicherem Instinkt, wenn jemand Angst hat.
Geschichte einer Heilung
Eine junge Frau meldet sich bei einem bekannten Instruktor eines Hundevereins und erkundigt sich, ob sie einem der nächsten Erziehungskurse beiwohnen dürfte: Sie habe entsetzliche Angst vor Hunden. Wenn sie nur schon einen Hund von weitem erblicke, wechsle sie die Strassenseite und wage sich kaum auf einen Spaziergang. Sie leide unter diesem krankhaften Gefühl und möchte in einer Begegnung der Sache auf den Grund gehen, um vielleicht dieser Angst Herr zu werden. Eine Psychologin rät dem Trainer, die erste Begegnung ohne Hund durchzuführen. In einem zweiten Schritt besuchte die junge Frau eine Züchterin mit einem frischen Wurf. Zuerst konnte sich die Frau nicht überwinden, die Welpen auch nur zu berühren. Bei einem zweiten Besuch kamen die junge Frau und der Instruktor dazu, als ein Welpe eben mit der Flasche gefüttert wurde. Beim Anblick des trinkenden «Säuglings» entspannten sich die Gesichtszüge der Frau und wurden zusehends weicher. Kurze Zeit später fütterte sie den Welpen sogar selbst. Als die Welpen heranwuchsen, kam sie wieder, spielte mit ihnen, führte einen jungen Hund an der Leine, verspürte aber noch immer das ängstliche «Gruseln», Hunde zu berühren.Es vergingen Wochen, da kam die junge Frau erneut auf den Trainingsplatz. Es ging ihr besser, dennoch geriet sie leicht in Panik, als nach dem Unterricht alle Hunde frei herumtollten. Ein erneuter Besuch bei der Züchterin brachte Besserung. Monate zogen ins Land, die junge Frau tauchte nicht mehr auf. Bis eines schönen Tages im Herbst — der Unterricht hatte eben begonnen — stand sie wieder da. Diesmal in Begleitung ihres neuen Freundes, der seinen kleinen Hund an der Leine hatte...